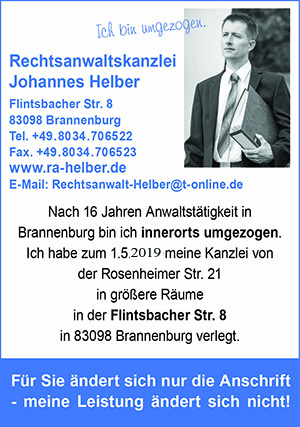Schadensminderungspflicht beim Verkehrsunfall
Das Thema Schadensminderungspflicht des Geschädigten ist mir in meiner Tätigkeit als Anwalt schon oft begegnet.
Wer bei einem Verkehrsunfall unverschuldet geschädigt wird, hat selbstverständlich Schadensersatzansprüche gegen die gegnerische Haftpflichtversicherung.
Er muss aber den Schaden so gering wie möglich halten.
Er hat also die zentrale Pflicht, den Schaden „im vernünftigen Rahmen“ zu halten und keine unnötigen Kosten zu erzeugen.
Zur Schadensminderungspflicht gibt es viele Konstellationen:
Nachfolgend drei Beispiele aus meiner Praxis:
1. Reparatur in Fach- oder freier Werkstatt?
Die Gerichte haben mehrfach entschieden, dass die Versicherung den Geschädigten in vielen Fällen auf eine freie Werkstatt verweisen kann, weil eine freie Werkstatt Stundensätze und Ersatzteilpreise in der Regel wesentlich niedriger als Markenwerkstätten kalkuliert.
Dies gelte jedenfalls dann, wenn die gegnerische Versicherung beweisen kann, dass die freie Werkstatt eine Reparatur in gleicher Güte und Qualität wie eine Fachwerkstatt durchführen kann und wenn die freie Werkstatt mühelos erreichbar ist.
Es gibt allerdings Ausnahmen, in denen die Versicherung den Geschädigten nicht auf eine freie Werkstatt verweisen darf.
Das beschädigte Kfz ist nicht älter als drei Jahre alt.
Der Beschädigte kann bei einem Fahrzeug, das älter als drei Jahre ist, durch Vorlage Rechnungen/Scheckheft beweisen, dass das Fahrzeug immer in einer markengebunden Fachwerkstatt gewartet und repariert wurde.
2. Mietwagen
Grundsätzlich hat der Geschädigte bei einem fremdverschuldeten Unfall natürlich einen Anspruch auf Ersatz von Mietwagenkosten.
Die Versicherung versucht aber gerne, hier zu „sparen“ und Abzüge durchzusetzen.
Ein Streitpunkt ist z. B. die Erstattungsfähigkeit des sog. Unfallersatztarifs. Das ist ein deutlich höherer Tarif, den Autoversicherungen teilweise nach einem Unfall verlangen.
Die Haftpflichtversicherungen sowie viele Gerichte sehen diesen Tarif aber nicht als ersatzfähig an, so dass man u. U. auf einem Teil der Mietwagenkosten sitzenbleibt.
Was kann der Geschädigte dagegen tun?
Ich empfehle insoweit einerseits, nicht den nächstbesten Autovermieter anzusteuern, sondern möglichst Preise bei Mietwagenunternehmen zu vergleichen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Mietdauer über drei Tage beträgt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, über die Versicherung einen Mietwagen zu erhalten.
Auch Werkstätten vermieten oft günstig Fahrzeuge. Mir sind insweit im hiesigen Raum einige Werkstätten bekannt.
Im Übrigen sollte sich der Geschädigte ein vergleichbares wie sein beschädigtes Fahrzeug, ggf. eine sog. Miewagenklasse niedriger, mieten. Er könnte also z. B. , wenn sein Golf beschädigt wurde, einen Polo anmieten.
Es macht sicherlich Sinn, sich möglichst zeitnah nach einem Unfall mit einem Anwalt kurzzuschließen, um auch diesen Punkt zu klären.
3. Restwertangebot der gegnerischen Haftpflichtversicherung
Bei einem Totalschaden muss sich der Geschädigte vom sog. Wiederbeschaffungswert den sog. Restwert abziehen lassen.
Im Sachverständigengutachten finden sich im Regelfall Restwertangebote von sog. Restwertbietern, beispielweise ein Betrag i. H. v. 500 EUR.
Wenn die Versicherung das Sachverständigengutachten erhält, macht sie im Regelfall ebenfalls Restwertangebote, beispielsweise hier 800,00 EUR.
Problematisch kann es hier dann werden, wenn der Geschädigte sein Fahrzeug unmittelbar nach Erhalt des Sachverständigengutachtens zum Restwert aus dem Gutachten – hier 500 EUR – verkauft, bevor die gegnerische Haftpflichtversicherung das Gutachten erhalten hat. Die Versicherung will hier natürlich ihre 800 EUR Restwert ansetzen, um einen möglichst hohen Betrag vom Wiederbeschaffungswert abzuziehn und wird das häufig auch so versuchen. Der BGH sagt dazu allerdings, dass der Geschädigte nach einem Totalschaden sein Fahrzeug im Vertrauen auf dem im Gutachten festgelegten Restwert verkaufen dürfe. Er müsse der gegnerischen Haftpflichtversicherung nicht zunächst die Chance geben, diese Summe zu prüfen.
Probleme kann es auch dann geben, wenn der Geschädigte sein Fahrzeug – ggf. nach Teilinstandsetzung – weiternutzen möchte. In dem Fall wird die Versicherung häufig versuchen, ihren eigenen Restwert – hier 800 EUR – durchzusetzen. Der BGH hat aber klargestellt, dass in diesem Fall nur der in einem Sachverständigengutachten für den regionalen Markt ermittelte Restwert in Abzug zu bringen ist.
Meine Ausführungen zur Schadensminderungspflicht stellen keine Rechtsauskunft dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sie sollen lediglich einen ersten Eindruck zur Problematik verschaffen.